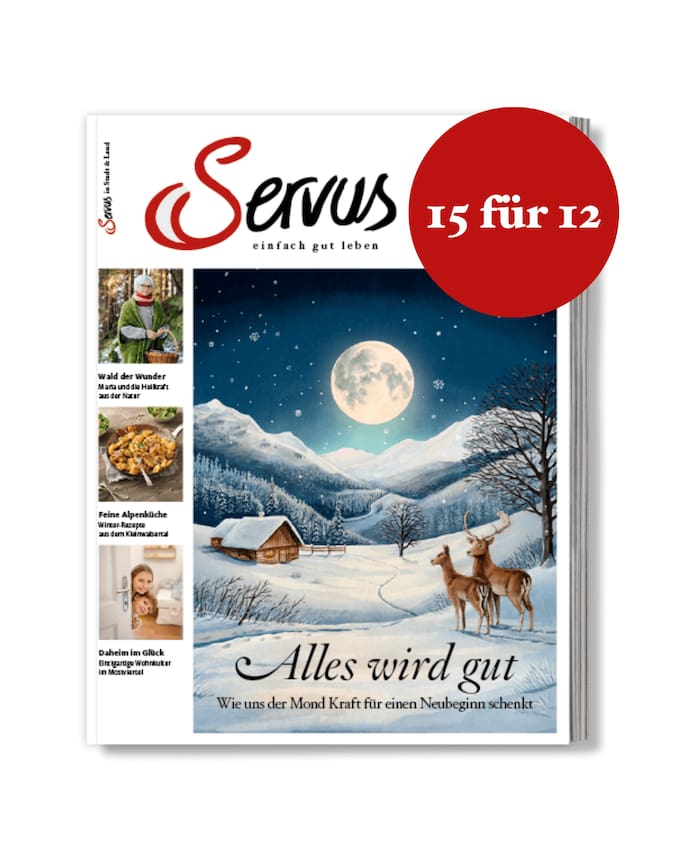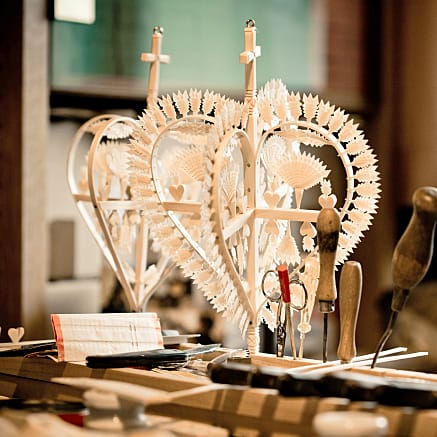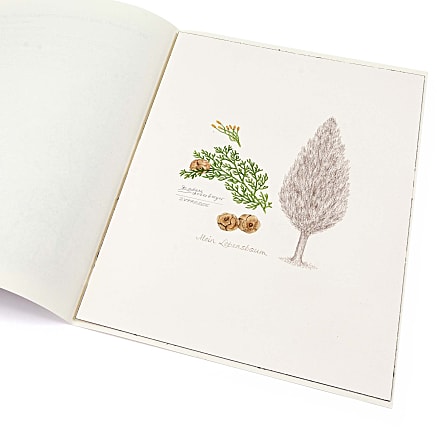Eisstockschießen: Regeln, Geschichte und Wörterbuch
„Sechse, neine, aus!“ Wenn in diesen Tagen das klassische Eisstock-Einmaleins über Teiche und Seen schallt, ist wieder die Zeit des beliebten Volkssports angebrochen.

Wer hat das Eisstockschießen erfunden?
Wer einmal dabei war, weiß: Das Spiel auf dem Eis ist eine gesellige Angelegenheit, die trotz kalter Zehen das Herz wärmt. Erfunden wurde es nicht erst gestern.
Die Ursprünge des Eisstockschießens – oder Eisschießens, wie es auch genannt wird – dürften im Mittelalter liegen.
Bis heute gehen die Meinungen auseinander, wer sich die Erfindung auf seine Fahnen heften darf. Manche Quellen vermuten die Vorläufer in Skandinavien, wo es schon im 13. Jh. dem Eisstockschießen verwandte Wurf- und Schubspiele gegeben haben soll. Andere schreiben die Urheberschaft den Niederländern zu: Auf dem Gemälde „Die Jäger im Schnee“ von Pieter Bruegel d. Ä. aus dem Jahr 1565 sind unter anderem Eisschützen zu sehen. Diese idyllische Szene könnte der Maler aber auch von seinen Reisen aus dem Alpenraum mitgebracht haben: Österreich, Bayern und Südtirol sind noch heute Kernländer der „Stöckler“. Historisch nicht gesichert ist auch jene gern erzählte Geschichte, der zufolge Babenberger-Herzog Leopold V. gerade beim Eisschießen auf der Alten Donau war, als ihn im Dezember 1192 die Kunde von der Gefangennahme seines Rivalen König Richard Löwenherz erreichte. Vielleicht waren’s ja doch die Österreicher …
Sei’s, wie’s sei: Unterhaltsamer als mit Eisschießen kann man sich die Zeit im Winter kaum vertreiben. Gesellschaftliche Grenzen sind hier aufgehoben, jeder spielt mit jedem. Wie es mit dem Eisschießen weitergeht, wenn sich die Winter immer weniger wie Winter gebärden? Professionell organisierte Stocksportler spielen schon heute das ganze Jahr über auf Asphalt oder Kunsteis – doch das ist eine andere Geschichte. Solange es noch friert, ist der schönste aller Eisstockplätze der Weißensee. Als höchstgelegener der großen Kärntner Badeseen (930 m ü. A.) wartet er zwischen Dezember und März mit einer bis zu 58 Zentimeter dicken Eisdecke auf. An rund 80 Tagen im Jahr darf er sich „größte Eisfläche der Alpen“ nennen.
Spielregen fürs Eisstockschießen
Seit 1900 ist das eisige Vergnügen bei uns in Vereinen organisiert, seit 1921 gibt es ein offizielles Regelwerk. 1951 wurden erstmals Europaund 1983 Weltmeisterschaften im Stockschießen ausgetragen. Man unterscheidet diverse Ziel- und Weitschießen sowie den klassischen Mannschaftswettbewerb, bei dem es darum geht, den Stock in Bestlage zur Daube zu platzieren – sei es durch eigene Zielgenauigkeit, durch das Wegschießen gut platzierter gegnerischer Stöcke oder das Verschieben der Daube zugunsten von Moarschaftskollegen.
Zählweise und Punktevergabe variieren regional und von Spiel zu Spiel – und auch die Siegesprämie wechselt. Mal bekommen die Gewinner ein Backhendl, mal ein Zielwasser im Stamperl und manchmal sogar den großen Servus Alpenpokal.
Die Mannschaft
Eine Mannschaft, im Eisschützenjargon „Moarschaft“ genannt, besteht in der Regel aus vier bis sechs Spielern.
Im Gegensatz zum organisierten Stocksport sind der Größe der Moarschaft beim gaudimäßigen Schießen keine Grenzen gesetzt. Zu viele Schützen sollten es jedoch nicht sein, weil sich das Spiel sonst zu sehr in die Länge zieht.
Gibt es eine ungerade Zahl an Schützen, so schießt der Mannschaftsführer, der „Moar“, zweimal. Moar zu sein ist eine ehrenvolle Aufgabe: Er gibt die Kommandos und hat das letzte Wort, wenn es bei diesem friedlichen Spiel doch einmal zu Unstimmigkeiten kommen sollte.
Der Stock
Der Stock ist das wichtigste Utensil des Eisschützen. Er muss einiges aushalten und ist daher (meist) aus hartem Birnen- oder Ahornholz gemacht, weswegen er bisweilen auch „Birnstingl“ genannt wird. Ist das Eis sehr glatt, werden auch Stöcke aus Birken- oder Pappelholz verwendet – weicheres Holz läuft langsamer.
Der Stiel (auch „Stingl“ oder „Stutzl“ genannt) ist aus Esche gefertigt, einem besonders harten und langfaserigen Holz. Es gibt auch Stiele aus Birkenholz, die sich wärmer anfühlen. Am Fuß des Stocks sitzt ein Ring aus gebogenem Flacheisen, der für die Schlagkraft verantwortlich ist. Es gibt Stöcke für Männer, Frauen und Kinder; ein durchschnittlicher Eisstock aus Holz wiegt im Schnitt zwischen vier und fünf Kilo. Das Gewicht sollte auf den Schützen bzw. seine Kraft abgestimmt sein. Der schwerste Stock wird meist vom Moar (siehe „Die Mannschaft“) verwendet, er setzt den ersten Schuss. So wird es für die nachfolgenden Spieler schwieriger, den Stock hinaus-, sprich: von der Daube wegzudrängen.
Die Sprache
Wer sich unter Eisschützen bewegt, wähnt sich mitunter in einem fremden Land. Da ist etwa vom „Techteln“ die Rede, von der „Fuaßn“, vom „Maß“ und vom „Schneider“. Je nach Region ließe sich die Liste beliebig lang fortsetzen. Jedes Bundesland – ja, jedes Tal – hat seine eigene Eisschützensprache.
Daher an dieser Stelle nur eine kleine Übersetzung des oben Geschriebenen: Bevor man sich aufs Eis begibt, muss man seinen Eisstock mitunter für mehrere Tage ins Wasser stellen (techteln), damit der lose gewordene Eisenring wieder fest sitzt. Einmal auf dem Eis, stellt man seinen Fuß in die Fuaßn, eine zirka 15 Zentimeter lange Kerbe, die als Standhilfe in das Eis gehackt wird. Zu Beginn des Spiels setzt der Moar eine Maß, einen Schuss, an dem sich die anderen zu orientieren haben. Und am Schluss hat hoffentlich der Gegner einen Schneider – hat also keine Kehre (= Durchgang) gewonnen.
Eisschützen-Abc
Daube: Zu ihr zieht’s alle hin. Wer dem kleinen Holzwürfel mit seinem Eisstock am nächsten kommt, hat die Nase vorn.
Fuaßn: Rille im Eis, die jene Stelle markiert, bis zu der sich der Schütze vorwagen darf und wo er beim Schuss seinen hinteren Fuß platziert.
Stutzl: Der hölzerne Stiel des Eisstocks, er wird mit einem Faustl eingeschlagen. Olympiastöcke haben in ihrem Bauch ein Gewinde, dort wird der Stutzl hineingeschraubt.
Techteln oder wassern: Eine Möglichkeit, lockere Ringe durch Einweichen in Wasser wieder fest an den Eisstock zu binden; sollte aber keinesfalls zu ausufernd und schon gar nicht mit heißem Wasser praktiziert werden.
Moar: Er führt die Mannschaft an und ist in der Regel ein guter und erfahrener Eisschütze; er weist seine Mitspieler an, wohin sie ihren Schuss lenken bzw. wie sie diesen anlegen sollen. Der Begriff stammt aus dem Mittelalter, in dem der Verwalter eines Gutshofes als „Meier“ oder „major domus“, also Hausmeier, bezeichnet wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:
15x nach Hause bekommen & nur 12x bezahlen
Wunsch-Startdatum wählen & kostenlos nach Hause liefern lassen
Mindestlaufzeit: 12 Ausgaben, Erscheinungsweise: 12x im Jahr
Jederzeit mit 4-wöchiger Frist zum Monatsende schriftlich kündbar (nach Mindestlaufzeit).