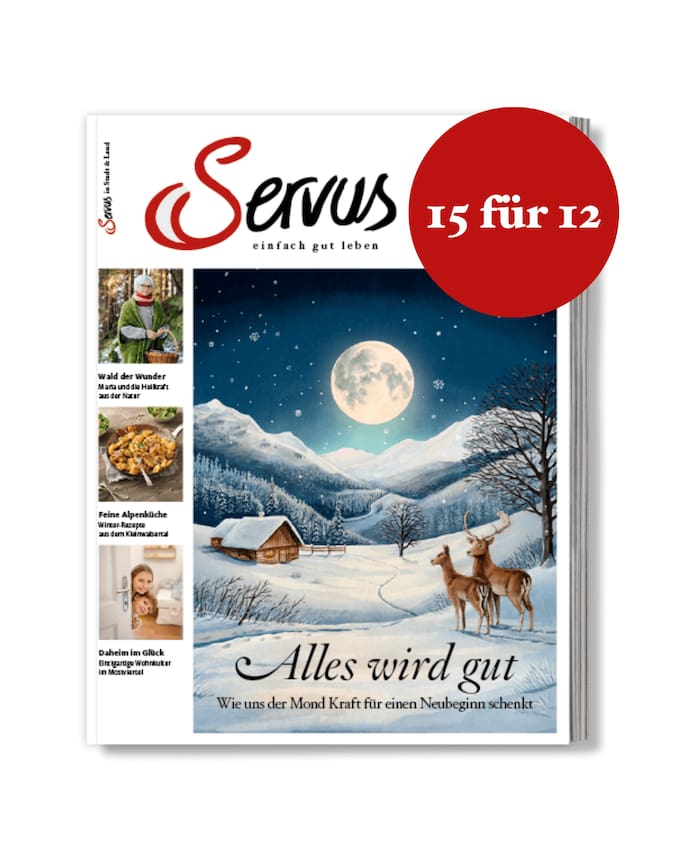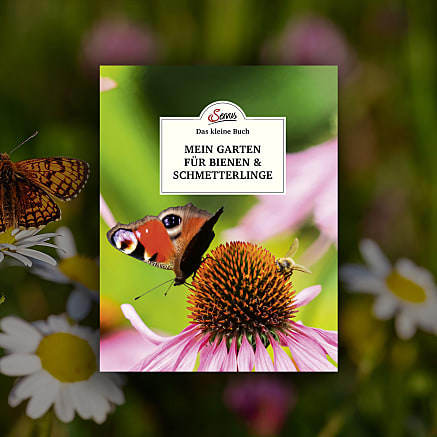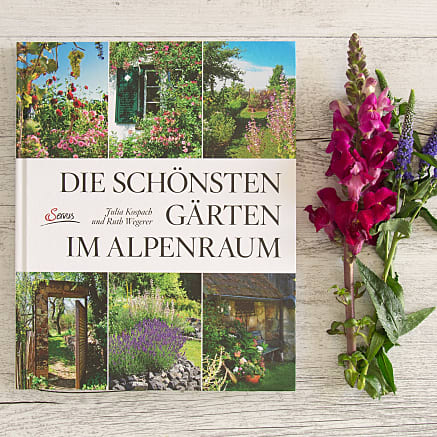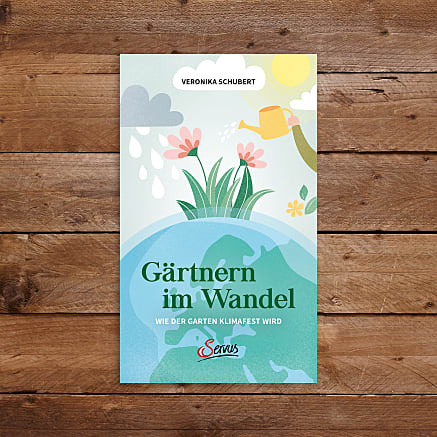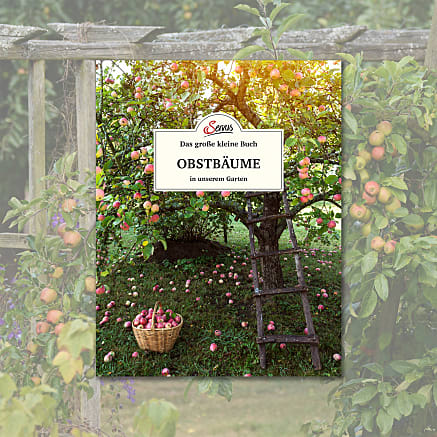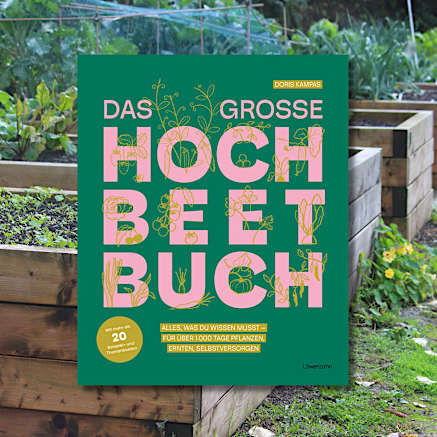Sagen und Mythen rund um „Gewitterpflanzen“
In früheren Zeiten waren die Menschen mehr noch als heute um die Ernte besorgt. Es gab keine Versicherungen gegen Unwetter. Und so versuchte man, sich dagegen mit allerlei Zauber und Pflanzen zu schützen.

Heute sind diese besonderen Gewächse vor allem schön im Garten. Aber wer weiß, vielleicht helfen sie ja doch auch ein bisschen gegen Ungemach von oben. Eine schaut sogar aus wie ein Blitzableiter … Nach dem Volksglauben konnten Pflanzen Gewitter und Blitz anziehen oder abwehren. Als blitzgefährlich betrachtete man meist Pflanzen mit blauen oder roten Blüten. Dabei war man sich nicht ganz einig: Manchen blau blühenden Pflanzen schrieb man eine blitzabwehrende, aber auch eine blitzanziehende Wirkung zu, die rot blühenden betrachtete man meist als blitzanziehend. Zunächst fragen wir uns aber:
Woher kommen Blitz und Donner eigentlich?
Rein sprachlich hat er sich aus dem althochdeutschen bleckezzen entwickelt, das wiederum zum mittelhochdeutschen blecken (aufblitzen lassen) führte. Auch das Wort Blick entstand daraus, als Ausdruck für das Aufblitzen der Augen. Die Herkunft von Blitz und Donner war für die Menschen früherer Zeiten, die von Elektrizität nichts wussten, natürlich ein Mysterium. Daher gab es viele Geschichten und Mythen rundherum.
Eine Sage erklärt die Entstehung so: Als der Heiland am Kreuz gestorben war, wurde der Teufel böse, denn er dachte, nun würden alle Menschen in den Himmel kommen. So beschloss er, die Menschen mit dem Donner zu erschrecken. Gott entgegnete: „Böser Satan, ehe du donnerst, will ich mein Feuer aus dem Himmel senden, um die Menschen zu warnen. Sie sollen sich bekreuzigen, und du sollst keine Macht haben.“
In noch früheren Zeiten glaubten vor allem die germanischen Völker, dass Blitz und Donner die Waffen eines mächtigen Gottes seien. Das lag ja auch nahe – das Grollen und Donnern mag an eine Schlacht erinnern und das Blitzen an das Funkeln der Schwerter. Die Donnergötter waren gefürchtet, aber auch geachtet, denn sie schickten nicht nur das Gewitter, sondern auch den Regen, der die Felder befruchtete.
Der Gewittergott schlechthin war Thor, auch Donar genannt. Er hatte feuersprühende Augen und verfügte durch einen magischen Gürtel über besondere Kräfte. Man sagt, er habe den Hagelriesen bekämpft. Thor schützte also die Menschen vor bösen Dämonen.
Später, als das Christentum Fuß fasste, wurde der Teufel an Donars Stelle gesetzt – und die Hexen als seine „Gefolgsweiber“ waren fortan schuld, wenn ein Gewitter mit Wind, Regen und Hagel die Saat vernichtete. Daher wurde so ein Gewitter im Volksmund auch Hexenwetter genannt; und so manch einer berichtete, dass er gesehen habe, wie die Hexen im Unwetter in der Luft vor Freude Purzelbäume schlagen.
Vor allem aber war man davon überzeugt, dass die Hexen Hagel machen können, indem sie in ein stehendes Gewässer Steine werfen oder es schlagen. Als das wirksamste Mittel, um Wetterhexen zu vertreiben, wurde stets das Glockenläuten angesehen, doch es gab noch viele andere Wege, um sich vor Unwettern zu schützen.
Pflanzen, die den Blitz anziehen sollten
Glockenblume (campanula sp.)
Donnerglocke nennt man sie in Oberbayern, und man sollte sie unter keinen Umständen ins Haus bringen, denn sonst schlägt der Blitz ein. Glockenblumenarten gibt es bei uns viele, meist blühen sie wunderschön blau mit einigen Ausnahmen. So blüht die Strauß-Glockenblume (C. thyrsoides), die in den Alpen wächst, gelb, und es gibt auch Zuchtformen, die weiß oder gefüllt blühen.
Man sollte keine Angst haben, so entzückende Pflanzen wie die Marien-Glockenblume (C. medium) in den Garten zu bringen. Sie stammt aus dem Süden, wurde jedoch schon lange in den Bauerngärten kultiviert. In England erzählt man, dass Elfen die Blüten gerne als Kopfbedeckung verwenden, und das sollte wohl auch den Garten schützen.

Klatschmohn (papaver rhoeas)
Feuerrot sind seine Blüten, und daher gilt er auch als gewitteranziehend. Nach einem alten Volksglauben ist es Kindern verboten, die Blütenblätter des Klatschmohns abzuzupfen, da dies ein Unwetter mit Blitz und Donner heraufbeschwören könnte.
Andererseits sagt man in manchen Gegenden, dass Klatschmohn im Garten vor dem Einschlagen schützt.
Als Ackerbeikraut ist er schon selten. Deshalb sollte man sich nicht scheuen, ihn in den Garten zu bringen und sich über die roten Farbtupfer in den Blumenbeeten zu freuen.

Kornrade (argostemma githago)
Die dunkelrosa blühende Kornrade durfte man, obwohl sie eine schöne Blüte hat, nicht in die „Johannissträuße“ geben, die unter anderem auch helfen, den Blitz abzuhalten.
Die Kornrade zu diesen zauberkräftigen Pflanzen dazuzugeben könnte ja genau das Gegenteil bewirken. Die Kornrade war früher ein sehr häufiges Beikraut in Getreideäckern. Durch moderne Saatgutreinigung und den intensiven Ackerbau gilt die wildwachsende Kornrade als fast ausgestorben.
Zum Glück gibt es heute Samen zu kaufen. 2003 wurde sie zur Blume des Jahres gewählt, auch um auf die Wichtigkeit des Kulturguts Ackerwildkräuter hinzuweisen. Essen sollte man die Kornrade auf keinen Fall, da sie giftig ist.

Frühlings-Enzian (gentiana verna)
„Blitznagele“ nennt man diese wunderschöne Pflanze, und in der Schwäbischen Alb sagt man „Hausa(n)brenner“. Enzian darf keinesfalls abgerissen werden, da dies nicht nur den Blitz anzieht, sondern sogar zum Tod führen könnte, glaubte man früher. Deshalb nannte man ihn in der Schweiz auch „Tötli“.
Mit solchen Attributen versehen, war der Enzian früher nicht in Gefahr, ausgerottet zu werden. Heute steht er unter Naturschutz.

Feuerlilie (lilium bulbiferum)
Mit ihrer leuchtenden Farbe sprach man ihr schon immer zu, dass sie etwas mit Blitzen zu tun hat. Deshalb sagt man auch Donnerrose zu ihr. Einerseits sollte man sie nicht ins Haus bringen, weil das den Blitz anziehen würde, andererseits wurde sie in den Sonnenwendbuschen gegeben, der ins Feuer geworfen wurde, um Unwetter abzuhalten.
Die Feuerlilie ist eine der prächtigsten Blumen der Alpenwelt. Sie gehört von alters her zu den Gartenschätzen. Vor allem in Klostergärten wurde sie kultiviert und fand von dort ihren Weg in die Bauerngärten.
Wenn man sie nicht als Schnittblume ins Haus bringt, muss man sicher keine Angst vor der „blitzgefährlichen“ Feuerlilie haben.

Alpenrose (rhododendron sp.)
Die wahre „Donnerrose“ der Alpen ist der Almrausch, wie er auch genannt wird. Ein alter Gebirgsglaube ist es, keinesfalls die giftige Alpenrose bei sich zu tragen, wenn man auf dem Berg unterwegs ist.
Eine Geschichte aus Südtirol erzählt, dass eines Nachts eine Sennerin von einem fürchterlichen Gewitter überrascht wurde. Mitten unterm Donnerkrachen hörte sie plötzlich die Stimme ihres Geliebten. Sie stand auf, um ihn bei dem Hundewetter in die Hütte einzulassen, aber weit und breit war niemand zu sehen. Dann legte sich die Dirn zur Ruhe. Doch beim nächsten Donner hörte sie wieder seine Stimme. So ging es auch ein drittes Mal. Dann schlief die Dirn ein. Doch am nächsten Morgen wurde ihr Geliebter nicht weit von der Hütte aufgefunden, vom Blitz erschlagen. Im Hutband hatte er eine Donnerrose. Daher weiß der Volksmund: „Almrausch am Hut tut dem Jäger nicht gut.“

Almrausch am Hut tut dem Jäger nicht gut.Volksmund
Pflanzen, die den Blitz abwehren sollten
Vielfach sind dies Pflanzen, die ganz allgemein als zauber- und unheilwidrig galten, allen voran die Weidenkätzchen, die am Palmsonntag geweiht wurden. Entweder wurden die Palmzweige in die Felder gesteckt, oder man streute bei drohendem Gewitter die getrockneten Palmkätzchen ins Herdfeuer. Nur muss man darauf achten, dass die Kätzchen direkt in die lodernde Flamme geworfen werden, sonst würde nämlich das Gegenteil eintreten – und der Blitz angezogen werden. Auch die Haselrute kann den Himmelsstrahl abwehren. Vor allem Haselzweige, die zu Mariä Heimsuchung (am 2. Juli) geschnitten wurden, sollten helfen, wenn man sie beim Aufkommen des Gewitters in die Schlüssellöcher der Türen steckt.
Brennnessel (urtica dioica)
Als „brennende“ Pflanze hat die Brennnessel naturgemäß eine Beziehung zum Himmelsfeuer der Blitze. In der altgermanischen Mythologie wurde sie dem Blitzeschleuderer Donar zugeordnet. Daher wurde die Brennnessel noch vielerorts Donnernessel genannt.
Rutengänger behaupten, dass die Pflanze gern dort wächst, wo sich Erdstrahlen oder Wasseradern kreuzen. Das sind genau jene Stellen, an denen der Blitz bevorzugt einschlägt.
Aber nach dem Prinzip, Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen, glaubte man, dass die Brennnessel auch vor Blitzschlag bewahrt. So wurde oft am Gründonnerstag (Donnerstag ist auch der Tag des Donar) ein Strauß Nesseln gepflückt und unter dem Dach aufgehängt, um das Haus zu schützen.

Hauswurz (sempervivum tectorum)
Zu den ältesten und wohl volkstümlichsten Blitzkräutern gehört die Hauswurz. Schon Dioskorides, der römische Kräuterschriftsteller, schrieb, dass die „Hauswurz, welche wild an den Bergen wächst, auch auf den Dächern gepflanzt wird“.
Donnerwurz oder Donnerbart wurde sie genannt, weil auch sie Donar geweiht war. Aber auch Jupiter war so wie Zeus ein Blitzeschleuderer, und Karl der Große befahl in seinem „Capitulare de villis“, der Landgüterverordnung, die Anpflanzung der Hauswurz: „Et illa hortulanus habeat super domum suam Jovis barbam“ („Und der Landmann soll Jupiterbart auf seinem Haus haben“).
Ursprünglich mag die Hauswurz vielleicht nur den Zweck gehabt haben, lose Ziegel- oder Schindeldächer zusammenzuhalten oder Lehmdecken vor dem Auswaschen durch Regen zu schützen. Hauswurzen sind so genügsam, dass sie auch auf Beton wachsen können, wenn man ihnen nur einen Hauch von Erde zukommen lässt.
Dass der Hauswurz seit jeher eine blitzabwehrende Wirkung zugesprochen wurde, ließe sich so erklären: Die Hauswurz-Rosetten mit all den Spitzen ihrer einzelnen Blättchen könnten die elektrische Spannung, die bei einem Blitz entsteht, über das Dach verteilen. Moderne Blitzableiter bestehen heutzutage aus Büscheln fein zugespitzter Drähte. Sie scheinen also den Blattspitzen der Hauswurz nachempfunden zu sein.
Aus der Hauswurz könnte man auch eine Salbe gegen Verbrennungen machen. Besonders wirkungsvoll ist diese angeblich, wenn man die Pflanze in der Zeit zwischen dem ersten Blitz und dem darauf folgenden Donner erntet.

Arnika (arnica montana)
Eine gewitterabwehrende Wirkung sprach man auch den Pflanzen im Sonnwendbuschen zu, ebenso wie den Kräutern im Himmelfahrtsbuschen, die in der Kirche gesegnet wurden. Die berühmteste Gewitterpflanze war die Arnika. Haus und Stall schützte man gegen Blitzschlag und Hagel durch unters Dach gelegte Arnikabüschel.
Da die Arnika heute überall unter Naturschutz steht, sollte man besser das Johanniskraut (Hypericum perforatum) als „pflanzlichen Blitzableiter“ nutzen. Wenn ein Gewitter droht, wirft man ein paar getrocknete Johanniskrautblüten ins Feuer oder räuchert damit. Vorbeugend kann man die Pflanze aber auch ans Fenster stecken, so wie das in Tirol und Bayern früher Brauch war.
Wegen seiner harten Stängel nennt man das Johanniskraut auch Hartheu, dessen gewitterabwehrende Wirkung sich im folgenden Sprüchlein ausdrückt: „Ist denn keine alte Frau, die kann pflücken Hertenau, dass sich das Gewitter stau!“

Das könnte Sie auch interessieren:
15x nach Hause bekommen & nur 12x bezahlen
Wunsch-Startdatum wählen & kostenlos nach Hause liefern lassen
Mindestlaufzeit: 12 Ausgaben, Erscheinungsweise: 12x im Jahr
Jederzeit mit 4-wöchiger Frist zum Monatsende schriftlich kündbar (nach Mindestlaufzeit).